 1979 erschien in erster Auflage das Buch: „Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation“ des jüdischen Philosophen Hans Jonas. Das Werk spiegelt das seit den siebziger Jahren zunehmende Unbehagen über Umweltzerstörung und technologische Entwicklungen mit kaum kalkulierbaren Risiken für die Menschheit wider. In erster Linie ist hier die Bedrohung durch das nukleare Wettrüsten zu nennen. Jonas diskutiert aber auch andere ethische Aspekte technologischer Entwicklungen, beispielsweise der Eugenik. Hans Jonas bezog damals eine klare Position und empfahl eindringlich, Technologien mit potentiell globalen und noch nicht vollständig erkannten Folgewirkungen strikt abzulehnen. Seit 1979 hat die Weltbevölkerung um 3 Milliarden Menschen zugenommen. Auch ohne technologieinduzierte Katastrophen sind planetare Belastungsgrenzen erreicht und teilweise bereits überschritten worden. Heute wie vor vierzig Jahren unbestritten ist der im „Prinzip Verantwortung“ formulierte „ökologische Imperativ“: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“
1979 erschien in erster Auflage das Buch: „Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation“ des jüdischen Philosophen Hans Jonas. Das Werk spiegelt das seit den siebziger Jahren zunehmende Unbehagen über Umweltzerstörung und technologische Entwicklungen mit kaum kalkulierbaren Risiken für die Menschheit wider. In erster Linie ist hier die Bedrohung durch das nukleare Wettrüsten zu nennen. Jonas diskutiert aber auch andere ethische Aspekte technologischer Entwicklungen, beispielsweise der Eugenik. Hans Jonas bezog damals eine klare Position und empfahl eindringlich, Technologien mit potentiell globalen und noch nicht vollständig erkannten Folgewirkungen strikt abzulehnen. Seit 1979 hat die Weltbevölkerung um 3 Milliarden Menschen zugenommen. Auch ohne technologieinduzierte Katastrophen sind planetare Belastungsgrenzen erreicht und teilweise bereits überschritten worden. Heute wie vor vierzig Jahren unbestritten ist der im „Prinzip Verantwortung“ formulierte „ökologische Imperativ“: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“
Seit April 2019 befasste sich eine Veranstaltungsreihe im Rahmen der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung mit ethischen Aspekten der Technologiewahl. Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe stand die Frage, ob die technologiepolitischen Implikationen des ökologischen Imperativs heute anders formuliert werden müssen als vor vierzig Jahren. Expert*innen diskutierten dies am Beispiel von Gen-Editierung (CRISPR CAS), Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) sowie Geoengineering. Viele Wissenschaftler*innen sehen hier große Potentiale, den Klimawandel zu begrenzen oder mit seinen Folgen besser umgehen zu können: Allerdings ist die Ablehnung in der deutschen Gesellschaft und Politik groß.
Auf der Schlussveranstaltung am 11.12. diskutierten Imme Scholz vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) und Jakob Rhyner von der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung einige der in den vergangenen Monaten aufgeworfenen Fragen. Diese wurden von Andreas Stamm (DIE) auf Basis der sechs vorangegangenen Panelveranstaltungen formuliert. Sie diskutierten, dass verantwortliches Handeln heute auch bedeuten kann, Technologien durch Forschung und Entwicklung für eine sichere Anwendung vorzubereiten, wenn von ihnen ein signifikanter Beitrag zur Bearbeitung globaler Herausforderungen erwartet werden kann. Neue Technologien können eine umfassendere Nachhaltigkeitstransformation nicht ersetzen, sondern nur begleiten. Zudem kommen nur Technologien, deren Wirkungen grundsätzlich umkehrbar sind, für eine potentielle Anwendung in Frage.
Die Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung/ Innovations-Campus Bonn (ICB) wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.


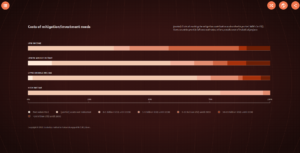 Sie interessieren sich näher für die Inhalte der Nationalen Klimaschutzpläne (NDCs)? Analysieren Sie mit unserem interaktiven
Sie interessieren sich näher für die Inhalte der Nationalen Klimaschutzpläne (NDCs)? Analysieren Sie mit unserem interaktiven