In Zusammenarbeit mit der Weltbank untersuchte Christoph Strupat, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprogramm Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme am DIE, die Wirkungen der landesweiten Krankenversicherung in Ghana. Die Autoren zeigen, dass es nicht nur Einsparungen bei den individuellen Gesundheitsausgaben gab, sondern die Krankenversicherung auch deutlich zur Verringerung von Kinderarbeit beiträgt und dadurch Kindern die Teilnahme am Schulunterricht ermöglicht. Hohe Krankheitskosten, Kinderarbeit und Bildungsarmut sind in vielen Entwicklungsländern eng miteinander verknüpft: Mangelnde Bildung und Gesundheitsversorgung ist eine der Hauptursachen für materielle Verarmung. Und ohne Bildung wird Armut häufig von einer Generation auf die nächste übertragen. Landesweite Versicherungen ermöglichen über die unmittelbare Versicherungsleistung hinaus einen zusätzlichen „sozialen Gewinn“ und können somit Kinderarbeit reduzieren und die Vererbung von Armut verhindern. Es lohnt sich daher diesen enormen Gewinn bei der Implementierung von Krankenversicherungen zu berücksichtigen.
Kategorie: Aus dem Institut
-
Das DIE beim International Cooperations Cup in Bonn

Das Team des DIE ©DIE Am 30. August fand wieder das mittlerweile schon traditionelle Fußballturnier der Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Zusammenarbeit in Bonn statt. Der International Cooperation Cup (ICC) wird seit 2013 ausgetragen und auch in diesem Jahr war das DIE wieder mit einem Team vertreten.
Im Verlauf des Turniers spielte das DIE u.a. gegen die DLR, gegen Flocert/Fairtrade, Don Bosco, die GIZ und Germanwatch. Im Halbfinale musste sich das DIE-Team jedoch der GIZ Eschborn geschlagen geben und spielte wie vor zwei Jahren wieder um Platz drei gegen die Deutsche Welle.
Der Respekt geht an die nahezu unschlagbare Truppe der GIZ Eschborn, ebenso der Dank für die Organisation eines fairen und außerordentlich schönen Turniers. Im nächsten Jahr kommen wir gerne wieder, vielleicht ist dann nicht im Halbfinale Schluss.
-
Neues aus dem Klimalog
TEG-CRM-Sitzung

Gruppenbild Klimalog und TEG-CRM © DIE Vom 29. bis 30. August 2019 war das DIE Gastgeber der ersten Sitzung der Technischen Expertengruppe für umfassendes Risikomanagement (TEG-CRM), die vom Exekutivkomitee des Warschauer Mechanismus für den Umgang mit Schäden und Verlusten (WIM ExCom) organisiert wurde. Die Sitzung bot eine einzigartige Gelegenheit für die strategische Verknüpfung verschiedener Forschungs- und Entwicklungsorganisationen im WIM-Prozess. Die Veranstaltung diente zudem als Plattform zur Entwicklung eines Aktionsplans für umfassende Risikomanagementansätze, um die Umsetzung des fünfjährigen fortlaufenden Arbeitsplans des WIM ExCom voranzutreiben.
Diese Veranstaltung wurde mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rahmen des „Klimalog“-Projekts organisiert.
UN-Klimagipfel

#climateactionsummit © UN 2019 Am 23. September fand der diesjährige Klimagipfel des UN-Generalsekretärs, António Guterres, statt. Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, der Jugend sowie aus Wirtschaft, Städten und Finanzen konzentrierten sich darauf, wie die Treibhausgasemissionen gesenkt und die Klimaresilienz verbessert werden können. Im Vorfeld des Gipfels wurde eine ganze Reihe von Berichten veröffentlicht, darunter der Bericht über „Globale Klimamaßnahmen von Städten, Regionen und Unternehmen“ des NewClimate-Instituts, des Data-Driven Envirolab, der Niederländischen Agentur für Umweltverträglichkeitsprüfung (PBL), des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) sowie der Blavatnik School of Government der Universität Oxford. Der mit Spannung erwartete Bericht schätzt die Auswirkungen einzelner Akteure und Kooperationsinitiativen auf die globalen und nationalen Emissionen. Dieser und andere Berichte zeigen, dass die Kluft zwischen Klimazielen und staatlichen Maßnahmen immer größer und die Auswirkungen des Klimawandels immer verheerender werden. Nur wenige der in New York versammelten Regierungschefs verkündeten jedoch eine Verschärfung ihrer Klimaziele und Maßnahmen.
Auf dem Gipfel wurden 28 Kooperationsinitiativen in neun Themenbereichen ins Leben gerufen; darunter Klimafinanzierung, Umstellung der Industrie, Minderung von Treibhausgasemissionen, Anpassung sowie ökosystembasierte Lösungen. Zu den auffälligen Initiativen gehört die „Asset Owner Alliance“, eine neue Koalition von Pensionsfonds und Versicherern, die über 2,3 Billionen US-Dollar verwaltet. Die Allianz zielt darauf ab, Investitionen von kohlenstoffintensiven Industrien abzuwenden, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C zu begrenzen. Allianzmitglieder arbeiten mit kohlenstoffintensiven Unternehmen zusammen, um sie bei der Einführung nachhaltiger Geschäftspraktiken zu unterstützen, während die Veräußerung von stark umweltbelastenden Industrien als letztes Mittel gehandelt wird. Die Allianz ruft andere große Vermögenseigner und Staatsfonds auf, sich zusammenzuschließen und ihre Anlageportfolios aufeinander abzustimmen. In einer weiteren großen Initiative haben die Bill and Melinda Gates Foundation zusammen mit der Weltbank, der Europäischen Kommission, Schweden, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland 790 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Forschung und Innovationen zur Verbesserung der Existenzgrundlage von Kleinbauern zugesagt, die den Auswirkungen des Klimawandels besonders ausgesetzt sind.
Bedauerlicherweise hat der Gipfel trotz aller Bemühungen der Organisatoren für eine bessere Verknüpfung zwischen nichtstaatlichen und lokalen Akteuren sowie Regierungen keine erhöhten Ambitionen auf staatlicher Ebene geweckt. Zwar haben einige Länder (Südkorea, Großbritannien, Deutschland und Frankreich) zugesagt, ihre Beiträge zum „Green Climate Fund“ und zu anderen Klimafinanzierungsprogrammen zu verdoppeln. Keine der großen Volkswirtschaften hat jedoch auf die Forderung reagiert, ihre Ziele zu erhöhen. Die nächste Gelegenheit für die Regierungen, gesteigerte Klimaziele und entsprechende Maßnahmen vorstellen, bietet sich im Dezember auf der UN-Klimakonferenz in Santiago, Chile. Die Zeit für glaubwürdige Klimaschutzverpflichtungen der Regierungen läuft ab. Ihre Untätigkeit zieht den Zorn einer wachsenden Bewegung besorgter Jugendlicher sowie älterer Generationen auf sich.
Mehrere Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DIE waren in New York vor Ort, um den Gipfel zu beobachten und mit ihren Forschungserkenntnissen zu der Debatte beizutragen.
NDC-Explorer: Neue Analysekategorie zu fossilen Brennstoffen
Die Forschung zeigt, dass die Mehrheit der bekannten fossilen Brennstoffreserven im Boden bleiben muss, wenn wir eine globale Erwärmung um 2 °C über dem vorindustriellen Niveau verhindern wollen. Der NDC Explorer, ein Online-Tool zur Analyse und zum Vergleich der (beabsichtigten) national festgelegten Beiträge der Länder (INDCs/NDCs), hat eine neue Analysekategorie. Diese visualisiert, welche Länder die Produktion fossiler Brennstoffe in ihren NDCs erwähnen.
„Es ist schön, dass so viele Länder in ihren NDCs Ziele für die Emissionsreduzierung und die Erzeugung erneuerbarer Energien festlegen“, bestätigt Pieter Pauw, Assoziierter Wissenschaftler am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) und Initiator des NDC Explorer. „Aber sie sollten auch in zukünftigen NDCs besser erklären, welche Maßnahmen sie ergreifen, um fossile Brennstoffe im Boden zu halten.“
Die neuen Daten, die von Cleo Verkuijl, Natalie Jones und Michael Lazarus vom Stockholm Environment Institute (SEI) gesammelt wurden, bereichern daher bestehende Erkenntnisse aus dem NDC Explorer und zeigen das Potenzial, durch nationale Verpflichtungen zu fossilen Brennstoffreserven ambitioniertere Klimaziele zu setzen. Die Daten über die Produktion fossiler Brennstoffe in den Ländern stammen von der Internationalen Energieagentur World Energy Balances (Ausgabe 2018), die die Länderdaten für 2016 berücksichtigt.Der NDC Explorer basiert ausschließlich auf Informationen, die von den Parteien der UNFCCC in ihren INDCs/NDCs übermittelt werden. Der Datensatz wurde gemeinsam vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE), dem African Centre for Technology Studies (ACTS) und dem Stockholm Environment Institute (SEI) in Zusammenarbeit mit dem UNFCCC-Sekretariat erstellt. Die Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance ist dem Konsortium 2018 beigetreten.
-
Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung zeigte Dynamik beim Thema Dürre

Michael Brüntrup mit Ibrahim Thiaw und Vertretern Sambias © DIE Am 13. September endete in Delhi die 14. Vertragsstaatenkonferenz (COP) des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD). Für die UNCCD war es ein Treffen der Superlative: fast 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 170 Stakeholder-Treffen, 44 Aussteller und 126 Seitenveranstaltungen. Zehn Tage lang wurde eine Vielfalt von Themen – teils hitzig – diskutiert und schließlich in 36 formalen Entscheidungen festgehalten, unter anderem zur Rolle von Frauen, der Bedeutung von Landrechten für nachhaltige Landbewirtschaftung, zum Monitoring, zur Bekämpfung von Dürren und zur engen Zusammenarbeit mit den anderen beiden Umweltkonventionen zu Klima (UNFCCC) und Biodiversität (CBD).
Michael Brüntrup war als deutscher Vertreter des Committee on Science and Technology (CST) bei der COP14 dabei und beriet die deutsche sowie die EU-Delegation zu CST-Themen und den weiteren Verhandlungen die Dürrebekämpfung betreffend. Dabei wurde erreicht, dass das neue Berichtssystem zu Dürre ambitionierter wird als ursprünglich vorgesehen, dass auch die Katastrophenhilfe-orientierten UN-Organisationen in die Arbeit aktiv einbezogen werden, und dass es ein starkes Mandat für weitere Bemühungen um Dürreresilienz in den nächsten Jahren gibt. Darüber hinaus nahm Herr Brüntrup auf mehreren Podiumsdiskussionen zu den Themen Dürre, Landdegradation und Armut/Ernährungssicherheit teil. Ein Trailer des von DIE und UNCCD gemeinsam produzierten Films The end of famine, der die Aktivitäten der lokalen Bevölkerung – vor allem von Frauen – in einem Dorf in der Region Tigray mit den Katastrophenhilfe-Einsätzen des Welternährungsprogramms in Äthiopien kontrastiert, wurde prominent zu Beginn der High-level Session beim Day of Drought gezeigt.
-
Studie zu nachhaltig erstellten Textilien
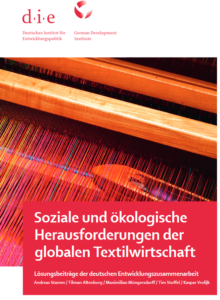
Cover der Studie © DIE Am 9. September gab das BMZ den Startschuss für das Siegel „Der Grüne Knopf“ für nachhaltig hergestellt Textilien. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) erstellte dazu die Studie „Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft“, die Bundesminister Gerd Müller im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellte. Bekleidung für den rasch wachsenden Weltmarkt wird fast ausschließlich in Entwicklungs- und Schwellenländern gefertigt, wo die Produktion erhebliche soziale und ökologische Probleme verursacht. Die Studie identifiziert drei Hauptproblemfelder in der Textil-Wertschöpfungskette: Arbeitsbedingungen in der Konfektion; Umweltprobleme in den vorgeschalteten Nassprozessen; und soziale und ökologischen Probleme in der Baumwollerzeugung. Die Studie dokumentiert insbesondere die beiden erstgenannten im Detail.
Darüber hinaus wird die deutsche Zusammenarbeit in diesem Bereich dargestellt, wobei vier Handlungsfelder unterschieden werden: (1) den Konsum nachhaltiger gestalten; (2) unternehmerische Sorgfaltspflicht einfordern; (3) die lokale Wertschöpfung in der Produktion steigern; und (4) Institutionen vor Ort stärken. Für jedes dieser Handlungsfelder werden Bereiche identifiziert, in denen künftig noch mehr getan werden sollte.
